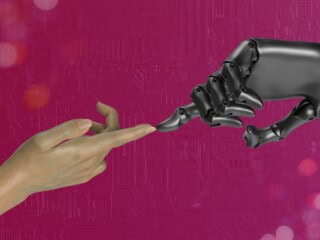Wieviel kostet gutes Suchmaschinenmarketing? Darüber gibt es immer wieder Diskussionen. Wir beleuchten die Vor- und Nachteile der Vergütungsmodelle aus Sicht von Kunden und Agenturen.
Fast jeder tut es, der ein Produkt oder eine Dienstleistung verkaufen möchte: Suchmaschinenmarketing (SEA). Egal ob Versicherung, Händler, Messeveranstalter, Autohersteller, Baumarkt oder Finanzdienstleister. Und nicht selten wird dieser wichtige Marketingkanal in die Hände von Experten gelegt, den Performance Agenturen. Diese messen, analysieren und optimieren nach Kräften. Wie aber bemisst sich ein richtiger und fairer Preis für die Marketingleistung der Agenturen?
Unternehmen wünschen sich ein Suchmaschinenmarketing, das ihre Ziele von Reichweite, Branding oder Umsatzsteigerungen bestmöglich bedient. Die Agentur soll dabei den Markt, die Wettbewerber und alle Player im Blick haben, beste Verbindungen zu Google und Bing pflegen, neue Features kennen und einsetzen. Jede Budgetänderung soll von der Agentur flexibel akzeptiert und umgesetzt werden. Die Agentur dagegen träumt von einem planbaren Honorar, auf dessen Basis sie die Ziele des Kunden verlässlich und bestmöglich bedienen kann. Das Honorar muss die täglichen Stunden der Experten für die Umsetzung der Kampagnen ebenso abdecken wie Zeit für Reportings, Meetings sowie Zeit für Fortbildung und Kontaktpflege zu den Netzwerken.
Welches Honorarmodell funktioniert hierfür wirklich gut? Wir stellen die gängigen Modelle vor: Das Prozentmodell, das fixe und das variable Modell sowie ein Hybridmodell. Auch ein Modell mit Abrechnung nach Aufwand ist denkbar, eignet sich aber nur für sehr kleine und begrenzte Projekte, weshalb wir es nicht weiter beleuchten.
1. Das Prozentmodell
Ein klassisches Vergütungsmodell der Werbebranche ist die Vereinbarung eines Prozentsatzes aus dem Gesamtbudget als Agenturhonorar. Wenn der Kunde in einem Monat zum Beispiel ein Monatsbudget von 50.000 Euro zur Verfügung stellt und die Agentur zehn Prozent als Fee erhält, dann fließen 45.000 Euro in die Kampagnen.
Vorteile:
Die Steuerbarkeit und Kontrolle der Ausgaben werden in diesem Modell von Kunden oft als Vorteil gesehen. Hintergrund ist der, dass die Budgethoheit für SEA meistens bei der Marketingabteilung liegt und eine bestimmte Höhe nicht überschreiten darf. Sinken die verfügbaren Budgets, passen sich auch die Agenturausgaben automatisch an.
Nachteile:
Die Agentur auf der anderen Seite kann schlecht mit den Einnahmen planen, da die Budgethöhe je nach Finanzsituation beim Kunden schwankt und nie garantiert ist. Schlechte Planbarkeit von Einnahmen und Ressourcen ist die Folge. Vor allem widerspricht dieses Modell dem Performance-Gedanken. Die Agentur verdient am meisten, wenn sie viel Budget ausgibt. Dabei ist es wirtschaftlich nicht immer sinnvoll, das volle Budget auszuschöpfen und eine gute Kampagnenoptimierung könnte die Budgets möglicherweise sogar senken. Der Kunde zahlt im Prozentmodell für qualitativ gute oder schlechte Kampagnen gleich viel bzw. die Agentur wird für gute Leistung möglicherweise sogar bestraft. Art, Umfang und Qualität der Leistung werden also unabhängig von der Leistung vergütet – ein Paradox im Performance Marketing.
Fazit:
Historisch gesehen hatte das Prozentmodell in Print und TV seine Berechtigung und Agenturen hatten als Einkommensbestandteil die Rabatte von Verlagen und Vermarktern, sogenannte AE-Provisionen. Die Zeiten haben sich geändert. AE-Provisionen gibt es im Search Advertising nicht und Verträge sind nicht mehr auf einzelne Werbeschaltungen begrenzt, sondern umfassen langfristige Kampagnen. Diese gilt es fortlaufend zu analysieren und zu optimieren. Gefragt sind heute vertrauensvolle Partnerschaften, bei denen die Agentur für den Kunden mitdenkt, proaktiv Verbesserungsvorschläge macht und die besten aktuellen Methoden zur Kampagnenoptimierung einsetzt. Der Aufwand hierfür verringert sich allerdings nicht, nur weil der Kunde kurzfristig das eingesetzte Budget reduziert, weshalb die Agentur schlussendlich wenig Anreiz hat, mehr als das Nötigste zur Kundenbetreuung beizutragen. Das Prozentmodell hat im Performance Marketing in heutiger Zeit keine wirkliche Berechtigung mehr.
2. Fixes Modell
Wie der Name schon sagt wird ein monatliches Fixum als Honorar vereinbart, das sich am zu erbringenden Aufwand orientiert. Hierzu ist es nötig, die Leistung genau zu definieren: Welcher Zeitumfang wird gebucht und welche Kampagnenteile werden umgesetzt, zum Beispiel Google und Bing Ads, Shopping oder Retargeting. Dazu gehören auch die Frequenz und der Umfang von Reportings oder Meetings beim Kunden.
Vorteile:
Die absolute Planbarkeit der Ausgaben und Einnahmen auf Agentur- wie Kundenseite ist ein großer Vorteil dieses Modells. Voraussetzung ist, dass die Leistungen nicht nur vage beschrieben sind, sondern genau definiert werden. Kenngrößen sind zum Beispiel Personentage, Stundenzahlen und involvierte Joblevel.
Nachteile:
Ein Fixum hat immer den Nachteil, auf veränderte Rahmenbedingungen nicht schnell reagieren zu können. Wenn sich, wie es immer wieder vorkommt, neue Features im Google oder Bing Umfeld ergeben, oder wenn ein neues Branding eine erhebliche Kampagnenausweitung erfordert, dann sollten Kampagnen schnell optimiert werden. Die erforderlichen Leistungen ändern sich fortlaufend, verschieben sich, neue Leistungen kommen hinzu, andere werden reduziert. Bei einem fixen Modell müssen folglich Äderungsverträge verhandelt werden. Das ist umständlich und zeitverzögernd, aber in diesem Modellunumgänglich.
Fazit:
Die inhaltliche Leere des Prozentmodells, was die Leistung der Agentur anbelangt, wird beim fixen Modell ersetzt durch eine genaue und vertraglich geregelte Leistungsbeschreibung, die nachvollziehbar und transparent ist. Hierdurch entsteht mehr Abstimmungsaufwand bei Vertragsschluss, doch es lohnt sich. Die Agentur wird nach ihrem tatsächlichen Aufwand entlohnt. Zusätzlich kann der Kunde Key Performance Indicators (KPIs) als Grundlagen der Kampagnensteuerung vorgeben, damit der Erfolg sichergestellt ist. Empfehlenswert sind jährliche Nachverhandlungen, damit der Dynamik der digitalen Werbewelt Rechnung getragen wird und die Agentur das Potenzial für den Kunden voll ausschöpfen kann.
3. Variables/Performance Modell
Ganz anders sieht das beim leistungsorientierten Ansatz aus. Dieser basiert voll und ganz auf den Zielen des Kunden, den KPIs. Soll die KUR (Kosten-Umsatz-Relation) auf zehn Prozent sinken oder die Reichweite um fünf Prozent steigen? Oder soll eine ehrgeizige Click-Through-Rate (CTR) erreicht werden? Diese Ziele sind messbar und können entsprechend vergütet werden. Die heutigen Reportings liefern zuverlässige Werte, die Zielerfüllung ist transparent und nachvollziehbar.
Die Agentur erhält bei diesem Modell ein Honorar, das sich am Zielerreichungsgrad orientiert. Das Budget trägt in der Regel der Kunde selbst. Nur sehr selten liegt im Performance Marketing das Budget auf Agenturseite, da der Kunde dann keine Details zum Kampagnenmanagement erhält und die Steuerung für ihn intransparent bleibt.
Vorteile:
Die Ziele des Kunden stehen im Fokus und die Agentur hat jeden Anreiz, alles für die Zielerfüllung zu unternehmen, also gute Qualität abzuliefern. Voraussetzung ist, dass die Ziele gut gewählt wurden. Sie sollten realistisch, messbar, beeinflussbar und herausfordernd gleichermaßen sein.
Nachteile:
Dieses Modell hat zwei Nachteile: Zunächst die Messbarkeit an sich. Während die Klicks stets verfügbar sind, beruht die Messung von Conversion oder Retargeting auf dem Tracking von Cookies. Seit Einführung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) lehnt ein Teil der Nutzer jedoch die Verwendung von Cookies zu Marketingzwecken ab, so dass diese Nutzer nicht mehr vollständig getrackt werden können. Zudem finden in der Regel mehrere Marketingkontakte auf verschiedenen Kanälen statt und führen schließlich zum Erfolg. Daher steht die übliche Last-Click-Messung zunehmend in der Diskussion. Customer-Journey-Bewertungen und Attributionsmodelle sind im Kommen, jedoch noch nicht immer ausgereift.
Der zweite Nachteil sind externe Einflüsse, die von Kunde und Agentur nicht gesteuert werden können. Dies können Marktgegebenheiten sein wie neue Wettbewerber, Lieferengpässe, Steueränderungen oder politische Entwicklungen von Brexit bis Dieselfahrverbot. Die Folgen können aus Agentursicht von Unterbezahlung bis zu traumhaften Honoraren reichen.
Fazit:
Performance ist eine attraktive Messgröße und ein guter Ansatz für eine faire und leistungsabhängige Bezahlung. Sowohl für Agentur als auch für den Kunden. Das Modell birgt jedoch erhebliche Gefahren. Wenn ein Sturm über Deutschland hinwegfegt und große Schäden anrichtet, dann ist das Risikoempfinden der Bürger besonders groß und eine Kampagne für Gebäudeversicherungen wird übermäßig profitieren. Genauso kann es passieren, dass eine perfekt optimierte Lebensmittelkampagne plötzlich nicht mehr läuft, weil eine neue Studie diese Lebensmittel für gesundheitsgefährdend hält. In beiden Fällen sind die Ergebnisse getrieben von externen Einflüssen und man muss sich fragen, ob das vereinbarte Vergütungsmodell solchen Umständen Rechnung trägt.
Aber auch wenn keine erkennbaren äußeren Einflüsse vorliegen kann es passieren, dass eine Agentur so hervorragend arbeitet, dass die Ziele weit übertroffen werden. Beim Kunden führt das nicht zwangsläufig zum Freudensprung, sondern vielleicht zum Gefühl, die Ziele zu niedrig angesetzt zu haben.
4. Hybridmodell
Ein Mixmodell, das die Vorteile von fix und variabel vereint sowie die jeweiligen Nachteile vermeiden soll, benennen wir mit „Hybridmodell“. Es besteht aus einem fixen und einem variablen Honoraranteil, der je nach Aufgabenstellung gewählt werden kann, beispielsweise im Verhältnis 70/30. Voraussetzung sind auch hier klare Ziele, genaue Leistungsbeschreibungen für den fixen Anteil und messbare KPIs sowie ein zuverlässiges Trackingsystem für den variablen Anteil.
Vorteile:
Der fixe Betrag soll beiden Seiten Sicherheit vor äußeren Einflüssen geben. Dem Kunden wird garantiert, dass Kosten nicht ins Uferlose steigen und die Agentur kann Kampagnen auch durch vorübergehende schlechtere Phasen weiterführen. Gleichzeitig gibt es immer noch einen starken Leistungsanreiz für die Agentur und für den Kunden Transparenz und erfolgsbasierte Kosten.
Nachteile:
Die Nachteile des fixen und variablen Modells bestehen natürlich auch in dem Hybridmodell – aber stark abgemildert, weil sie jeweils weniger Auswirkungen haben.
Fazit:
Das Hybridmodell kombiniert die Vorteile von zwei Modellen und nimmt dabei abgeschwächt die jeweiligen Nachteile in Kauf. Damit ist in vielen Fällen der Schritt in eine faire und leistungsbezogene Bezahlung sowie Planbarkeit und Transparenz sichergestellt.
Die eierlegende Wollmilchsau unter den Vergütungsmodellen…
… gibt es leider nicht. Zu komplex sind die Mechanismen im SEA, zu groß die Auswirkungen, oft intensiv die Einarbeitung in Kundenkonten und schlecht messbar die erbrachte Leistung der Agentur. Fest steht, dass die Zeit der kurzen Projekte vorbei ist. Unternehmen und Agenturen streben heute in der Regel nach vertrauensvollen, langfristigen Partnerschaften.
Welches Vergütungsmodell am sinnvollsten für Advertiser und Agentur ist, hängt zum großen Teil vom Advertiser und seinen Zielen ab. Für Retailer, die Ziele mit starken KPIs verfolgen wie Sales oder Leads, ist das Hybridmodell vermutlich die beste Lösung. Für schwächere Marken oder Hersteller mit komplexen und nicht immer komplett messbaren KPIs ist das Fixmodell empfehlenswert. Wichtig ist es in jedem Fall, eine Win-Win Situation zu schaffen, in der ein partnerschaftliches Klima entsteht und Maßnahmen verlässlich und effizient durchgeführt werden.
Die Weichen für Wahl des Vergütungsmodells werden bereits bei der Ausschreibung gelegt. Kunden vergeben ihre Budgets oft in aufwändigen und für die Agenturen sehr arbeitsintensiven Pitches. Damit der Kunde die Angebote vergleichen kann, muss er bei der Ausschreibung die richtigen Fragen stellen. Insbesondere die Frage nach dem Aufwand der Agentur, den Personentagen, den Tagessätzen. Auch eine verständliche und aussagefähige Aufgabenstellung in den Pitches ist nötig, damit vergleichbare Angebote abgegeben werden. Sind die Pitchanforderungen richtig gesetzt, dann ist die Basis für einen guten Honorarvertrag gelegt.